BEGRIFFE
Was ist das?
Sie werden
vielleicht
einige für Sie unbekannte Begriffe und Bezeichnungen, z.B. auf
meiner Homepage, gelesen haben. Hier möchte ich Ihnen diese
kurz
erläutern.
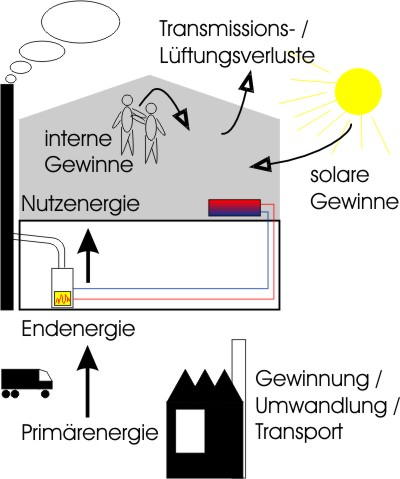
Energiebedarf
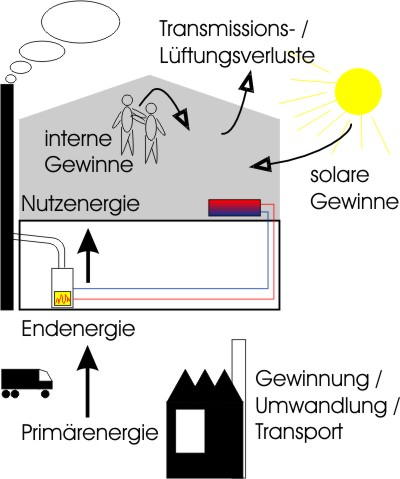
Energiebedarf
Energiemenge, die unter
genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten,
zu erreichende Innentemperatur, angenommene innere
Wärmequellen) für Beheizung,
Lüftung und Warmwasserbereitung (nur Wohngebäude) zu
erwarten ist. Diese Größe
dient der ingenieurmäßigen Auslegung des baulichen
Wärmeschutzes von Gebäuden
und ihrer technischen Anlagen für Heizung, Lüftung,
Warmwasserbereitung und
Kühlung sowie dem Vergleich der energetischen
Qualität von Gebäuden. Der
tatsächliche Verbrauch weicht
in der Regel wegen der realen Bedingungen vor Ort (z.B.
örtliche Klimabedingungen,
abweichendes Nutzerverhalten) vom berechneten Bedarf ab.
JahresheizenergiebedarfDas Ziel ist
es,
alle Wärmeverluste und -gewinne eines
Gebäudes zu erfassen, d.h. zu
bilanzieren. Der Transmissionswärmebedarf wird ebenso wie der
Lüftungswärmebedarf, die nutzbaren internen
Wärmegewinne und die Solarwärmegewinne
berechnet. Zusätzlich zu den Verlusten über die
Gebäudehülle werden die
Verluste der Anlagentechnik berücksichtigt. Die Anforderungen
an den nach dem
Energiebilanzverfahren ermittelten Jahresheizenergiebedarf sind in
Abhängigkeit
von A/V angegeben. Die Kennzahl A/V beschreibt das Verhältnis
der gesamten
wärmeübertragenden Umfassungsfläche (A)
eines Gebäudes zu dem hiervon
eingeschlossenen beheizten Bauwerksvolumen (V). Der
Jahresheizenergiebedarf
gibt somit an, wie viel Energie für die Beheizung eines
Gebäudes aufgewendet
werden muss. Die Berechnung erfolgt mit festgelegten Randbedingungen.
Durch
unterschiedliches Nutzerverhalten bzw. andere Randbedingungen kann der
tatsächliche Energiebedarf von dem errechneten abweichen.
EndenergieEnergieform,
wie sie nach der Aufbereitung eingesetzt
werden kann, z.B. Heizöl EL, Strom, Erdgas E,
Fernwärme usw.
EndenergiebedarfEndenergiemenge, die den
Anlagen für Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung und
Kühlung zur Verfügung
gestellt werden muss, um die normierte Rauminnentemperatur und die
Erwärmung
des Warmwassers über das ganze Jahr sicherzustellen. Diese
Energiemenge bezieht
die für den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung,
usw.) benötigte
Hilfsenergie ein.
Die Endenergie wird an der “Schnittstelle“ Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen der Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher besonders wichtige Angabe. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis getrennt nach verwendeten Energieträgern angegeben werden; bei Wohngebäuden kann er neben der auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Angabe und dem absoluten Wert (Gesamtbedarf für das Gebäude ) auch auf die Wohnfläche bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnfläche bezogene Bedarfswert ist in der Regel höher als der entsprechende, auf die Gebäudenutzfläche bezogene Wert, weil die Wohnfläche in der Regel kleiner ist als die Gebäudenutzfläche.
PrimärenergieDie Endenergie wird an der “Schnittstelle“ Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen der Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher besonders wichtige Angabe. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis getrennt nach verwendeten Energieträgern angegeben werden; bei Wohngebäuden kann er neben der auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Angabe und dem absoluten Wert (Gesamtbedarf für das Gebäude ) auch auf die Wohnfläche bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnfläche bezogene Bedarfswert ist in der Regel höher als der entsprechende, auf die Gebäudenutzfläche bezogene Wert, weil die Wohnfläche in der Regel kleiner ist als die Gebäudenutzfläche.
Primärenergie ist diejenige Energieform, die in der Natur
vorkommt, z.B. Erdöl, Uran, Erdgas, Holz, Kohle usw.
Jahres-PrimärenergiebedarfJährliche Endenergiemenge,
die zusätzlich zum
Energieinhalt des Brennstoffes und der Hilfsenergien für die
Anlagentechnik mit
Hilfe der für die jeweiligen Energieträger geltenden
Primärenergiefaktoren auch
die Energiemenge einbezieht, die für die Gewinnung, Umwandlung
und Verteilung
der jeweils eingesetzten Brennstoffe (vorgelagerte Prozessketten
außerhalb des
Gebäudes) erforderlich ist.
Die
Primärenergie kann auch als
Beurteilungsgröße für ökologische
Kriterien, wie
z.B. CO2- Emission, herangezogen
werden, weil
damit der gesamte
Energieaufwand für die Gebäudeheizung einbezogen
wird. Der
Jahres-Primärenergiebedarf ist die Hauptanforderung der
Energiesparverordnung.
EnergiekennzahlDie
Energiekennzahl gibt den
spezifischen
Heizwärmebedarf pro m² und Jahr in (kWh/m²a)
an. Das
ist eine Kenngröße, die aussagt, wie viel Energie
benötigt wird, um die gesamte
betrachtete Fläche zu beheizen. Diese Zahl beziffert nicht
unbedingt den
tatsächlichen Energieverbrauch; der kann sich davon z. T.
erheblich
unterscheiden.
So werden die bewohnten Räume unterschiedlich geheizt, und das Klima kann in den Jahren recht unterschiedlich sein.
Bauten nach der Wärmeschutzverordnung von 1995 erreichen einen Energieverbrauch für den Heizbedarf von ungefähr 100 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr; heutige Neubauten müssen etwas besser sein (Energieeinsparverordnung). So genannte Niedrigenergie-Häuser dieser Bauart verbrauchen hingegen nur noch 50 bis 70 kWh. Möglich sind im Neubau auch Passivhäuser, die auf Extremwerte von 15 kWh kommen, "3-Liter-Häuser" kommen auf 30 kWh. Betrachtet man Häuser, die vor 1984 gebaut wurden, so liegt der Energieverbrauch bedeutend höher, 250 bis 300 kWh sind keine Seltenheit.
Die Energieeinsparverordnung formuliert Grenzwerte von Energiekennzahlen, die sich an dem Primärenergiebedarf orientieren. Hierbei wird die weiter unten genannte (End-) Energiekennzahl mit einem Primärenergiefaktor für den eingesetzten Brennstoff multipliziert. Zurzeit darf der Wert eines durchschnittlichen Einfamilienhauses ca. 100 kWh/m²a nicht überschreiten, sollte aber deutlich darunter liegen (wünschenswert sind 54 kWh/m²a und weniger). Wir beziehen uns bei den Energiekennzahlen zunächst auf den Endenergiebedarf, der dem Einsatz von Brennstoff entspricht. Der Ölverbrauch wird damit auf höchstens 6-12 Liter pro m² und Jahr, der Gasverbrauch auf 6-12 m³a gesenkt.
Energiekennzahlen sind zu wichtigsten Vergleichsgrößen geworden. Mit ihr können auch Gebäude unterschiedlicher Größe und Lage miteinander verglichen werden.
In der
Spalte
"Energiekennzahl
heute" steht eine 15. Dies bedeutet, dass jetzt sogar Häuser
gebaut
werden, die keine Energiezufuhr von außen mehr
benötigen (also auch keine
Heizung!). Diese Nullenergiehäuser sind sehr gut "eingepackt",
verfügen über eine kontrollierte Lüftung mit
Wärmerückgewinnungsanlage und
Solaranlage mit ggf. saisonaler Speicherung. So ein Haus setzt ein
diszipliniertes Wohn- bzw. energetisches Verhalten voraus, d.h. kein
Lüften bei
kalter Jahreszeit über geöffnete Fenster, denn die
Frischluftzufuhr funktioniert
ja viel effizienter automatisch über eine eingebaute
Lüftungsanlage.
TransmissionswärmeverlustSo werden die bewohnten Räume unterschiedlich geheizt, und das Klima kann in den Jahren recht unterschiedlich sein.
Bauten nach der Wärmeschutzverordnung von 1995 erreichen einen Energieverbrauch für den Heizbedarf von ungefähr 100 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr; heutige Neubauten müssen etwas besser sein (Energieeinsparverordnung). So genannte Niedrigenergie-Häuser dieser Bauart verbrauchen hingegen nur noch 50 bis 70 kWh. Möglich sind im Neubau auch Passivhäuser, die auf Extremwerte von 15 kWh kommen, "3-Liter-Häuser" kommen auf 30 kWh. Betrachtet man Häuser, die vor 1984 gebaut wurden, so liegt der Energieverbrauch bedeutend höher, 250 bis 300 kWh sind keine Seltenheit.
Die Energieeinsparverordnung formuliert Grenzwerte von Energiekennzahlen, die sich an dem Primärenergiebedarf orientieren. Hierbei wird die weiter unten genannte (End-) Energiekennzahl mit einem Primärenergiefaktor für den eingesetzten Brennstoff multipliziert. Zurzeit darf der Wert eines durchschnittlichen Einfamilienhauses ca. 100 kWh/m²a nicht überschreiten, sollte aber deutlich darunter liegen (wünschenswert sind 54 kWh/m²a und weniger). Wir beziehen uns bei den Energiekennzahlen zunächst auf den Endenergiebedarf, der dem Einsatz von Brennstoff entspricht. Der Ölverbrauch wird damit auf höchstens 6-12 Liter pro m² und Jahr, der Gasverbrauch auf 6-12 m³a gesenkt.
Energiekennzahlen sind zu wichtigsten Vergleichsgrößen geworden. Mit ihr können auch Gebäude unterschiedlicher Größe und Lage miteinander verglichen werden.
| vor 1984 |
vor 1995 |
heute |
| 250 bis 300 kWh/m²a | 100 bis 250 kWh/m²a | 15 bis 100 kWh/m²a |
Wärmeverluste,
die dadurch entstehen, dass
Wärme durch die einzelnen Bauteile wie Außenwand,
Fenster, Boden oder Dach nach
außen ins Freie gelangt. Der Wärmestrom durch die
Außenbauteile wird je Grad
Kelvin Temperaturdifferenz gemessen. Es
gilt: je kleiner dieser Wert, umso besser ist die Dämmwirkung
der Gebäudehülle.
Durch zusätzlichen Bezug auf die
wärmeübertragende Umfassungsfläche liefert
der
Wert einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des
Wärmeschutzes. Nach der
Energieeinsparverordnung liegen die zulässigen
Höchstwerte zwischen 1,55 (große
Nichtwohngebäude mit Fensterflächenanteil
über 30 %) und 0,44 W/(m²K) (kleine
Gebäude).
AnlagenaufwandszahlSie beschreibt die
energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems
über Aufwandszahlen. Die Aufwandszahl stellt
das Verhältnis von Aufwand und Nutzen (eingesetzter Brennstoff
zu abgegebener
Wärmeleistung) dar. Je kleiner die Zahl, umso effizienter ist
die Anlage. Die
Aufwandszahl schließt auch die anteilige Nutzung erneuerbarer
Energien ein.
Deshalb kann dieser Wert auch kleiner als 1,0 sein.
Bei
der hier angegebenen “Anlagenaufwandszahl“ ist die
“Primärenergie“ einbezogen.
Die Zahl gibt also an, wie viele Einheiten (kWh) Energie aus der
Energiequelle
(z.B. einer Erdgasquelle) gewonnen werden muss, um mit der
beschriebenen Anlage
eine Einheit Nutzwärme im Raum bereitzustellen. Bei
Wohngebäuden ist in der
Anlagenaufwandszahl auch die Bereitstellung einer normierten
Warmwassermenge
berücksichtigt. Die Anlagenaufwandszahl hat nur für
die Gebäudeausführung
Gültigkeit, für die sie
berechnet wurde.
Auch
Hüllfläche genannt. Sie bildet die Grenze
zwischen dem beheizten
Innenraum und der Außenluft, nicht beheizten Räumen
und dem Erdreich. Sie
besteht üblicherweise aus Außenwänden
einschließlich Fenster und Türen,
Kellerdecke, oberste Geschossdecke oder Dach. Diese
Gebäudeteile sollten
möglichst gut gedämmt sein, weil über sie
die Wärme aus dem Rauminneren nach
Außen dringt.
Wärmedurchgangskoeffizient
= U-Wert
Der
U-Wert (bisher k-Wert genannt,
Wärmedurchgangskoeffizient, Einheit: W/m²K) ist
das Maß für den Wärmestrom, der
als Wärmeleitung von der wärmeren zur
kälteren Seite eines Bauteils fließt. Er
ist ein spezifischer Wert, der angibt wie viel Wärme (in Watt
= W) je Grad
Temperaturdifferenz (in Kelvin = K) zwischen Innen und Außen
durch einen
Quadratmeter (m²)
des betreffenden Bauteils wandert. Abhängig ist der U-Wert von
der Dicke des
Baustoffs und von den thermischen Eigenschaften, die durch die
spezifische
Wärmeleitfähigkeit ausgedrückt wird. Jeder
Baustoff hat eine für ihn
charakteristische Wärmeleitfähigkeit,
Dämmstoffe besitzen sehr niedrige,
massive Baustoffe wie Beton wesentlich höhere Werte.
Grundsätzlich
gilt:
Je kleiner der U-Wert, desto geringer die Wärmeverluste bzw.
desto besser die
Dämmeigenschaften.
WärmebrückenWärmebrücken sind
Zonen der
Außenbauteile, bei denen gegenüber der sonstigen
Fläche ein besonders hoher
Wärmeverlust auftritt. Neben der geometrischen gibt es
insbesondere
konstruktive Wärmebrücken, die an
Bauanschlüssen auftreten. An diesen Stellen könnte
sich im Übrigen die raumseitige Oberflächentemperatur
abkühlen und so Grundlage
für eine eventuelle Schimmelpilzbildung sein.
Wärmebrücken müssen deshalb
besonders konstruktiv behandelt und energetisch optimiert werden.
Gebäudeteile mit
stark erhöhter Wärmeübertragung, treten in
flächenhafter Form (wie z. B.
Rollladenkästen, Heizkörpernischen) und linearer Form
(Mauerecken, -anschlüsse)
auf. Flächen werden hier wie normale Bauteile mit ihrem U-Wert
qualifiziert.
Lineare Wärmebrücken werden mit einem linearen U-Wert
beziffert mit der Einheit
W/mK. Diese sind einerseits schwer zu beurteilen bzw. zu
quantifizieren,
andererseits tragen sie i. d. R. nur in relativ begrenztem Umfang zu
den Energieverlusten
bei (<5%). Von einer gesonderten Betrachtung wird daher hier
Abstand
genommen.
Alle
Wärmebrücken,
flächenhafte wie lineare, müssen im Zuge einer
Sanierung beseitigt werden.
Wärmebrücken verursachen Bauschäden durch
Feuchtigkeit.
Dichtheit
des GebäudesGemeint ist die
Dichtheit der
wärmeübertragenden Umfassungsfläche. Sie
soll sicherstellen, dass der Austausch
der Raumluft nicht unkontrolliert aufgrund der Wind- und
Luftdruckverhältnisse,
sondern gezielt nach hygienischen Erfordernissen oder sonstigen
Bedürfnissen
(z.B. Behaglichkeit, gesundes Raumklima) erfolgen kann.
Unerwünschte
Luftwechsel über Bauteilfugen sind nicht nur
zusätzliche Energieverluste, sie
können auch zu
Bauschäden führen, wenn
sich durch warme, feuchtigkeitsbeladene Luft in kalten Bauteilschichten
Tauwasser
bildet. Die Lüftung eines Gebäudes wird durch eine
nach dem Stand der Technik
dichte Ausführung nicht beeinträchtigt; sie kann nur
durch gezieltes,
wohldosiertes Öffnen der Fenster oder Lüftungsanlage
sichergestellt werden.
Lüftungswärmeverluste
Wärmeverluste
aufgrund von Undichtigkeiten von Gebäudeteilen.
Interne
Wärmegewinne
Bei
den internen Wärmegewinnen wird die
Abwärme von
elektronischen Geräten, Beleuchtung, Personen, etc. nach den
Richtwerten der
EnEV zusammengefasst.
Solare
WärmegewinneDies
sind die Wärmegewinne, die von der
Sonne
über Fenster, Fenstertüren sowie
Außentüren in Abhängigkeit von der
Himmelsrichtung dem Gebäude zugeführt
werden.
Bewertung der
EnergieträgerUm
die Umweltauswirkungen der unterschiedlichen Energieträger
darstellen zu
können, wird die ganze Prozesskette, d.h. von der
Förderung, über die Veredelung
und den Transport bis hin zum Endkunden, betrachtet.
Verluste
der FeuerstätteDie
Verluste einer Heizungsanlage, bezogen auf das ganze Jahr, setzen sich
aus den
Abgas-, den Abstrahlungs- und den Betriebsbereitschaftsverlusten
zusammen. Erst
der Jahresnutzungsgrad einer Feuerstätte kann aufzeigen, wie
gut oder schlecht
eine Feuerstätte ist.
Schadstoffe
Die Gefahr
einer Klimakatastrophe verstärkt zurzeit die
öffentliche
Diskussion um einen umweltverträglichen Energieeinsatz.
Hauptverantwortlich für
die drohende Klimaveränderung ist das Kohlendioxid. Aber auch
andere Gase, wie
z.B. unverbrannte Kohlenwasserstoffe, tragen das Ihrige dazu
bei.
Neben der Gefahr der
Klimaveränderung
tragen die Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler
Energiequellen
(Kohle, Öl, Gas etc.) verursacht werden, aber auch zu einer
Vielzahl von
weiteren Umweltbelastungen bei. Das Waldsterben, Atemwegserkrankungen,
Schäden
an Kulturdenkmälern, um nur eine kleine Auswahl zu nennen,
gehören auch dazu.
Kohlendioxid
(CO2) ist mit etwa 50% am so genannten
Treibhauseffekt
beteiligt. CO2 vermindert die
Wärmeabstrahlung der Erde in
den Weltraum. Dieser Effekt ist in einem bestimmten Umfang
erwünscht, wäre ohne
ihn doch ein Leben auf der Erde unmöglich. Wird das
Gleichgewicht, das sich in
Jahrmillionen eingestellt hat, durch eine Erhöhung des CO2-Gehalts
der Atmosphäre gestört, kommt es zu einer Aufheizung
der Erdatmosphäre mit
unberechenbaren Folgen für alle Lebensbereiche.
Die Menge des bei der Verbrennung
entstehenden Kohlendioxids hängt von der Kohlenstoffmenge des
Brennstoffes pro
Energieinhalt ab. Bei dem Faktor für
elektrischen Strom ist der durchschnittliche Kraftwerksmix der BRD
zugrunde
gelegt.
Die Umweltbelastung durch
Kohlendioxid kann
durch Energieeinsparung, die Verwendung kohlenstoffärmerer
Energieträger und
die Verwendung regenerativer Energieträger wie Sonne, Wind,
Wasser, Biomasse,
etc. reduziert werden.
Schwefeldioxid
(SO2) entsteht bei der Verbrennung von
Schwefel oder
Schwefelverbindungen, die vielfach als Verunreinigungen im Brennstoff
enthalten
sind. SO2 bildet in der
Atmosphäre Schwefelsäure und
wird als Hauptverursacher des sauren Regens (Waldsterben) angesehen. Die mit
Abstand höchsten SO2-Emissionen
werden durch die Kohlefeuerung, insbesondere Braunkohle, verursacht.
Leichtes
Heizöl emittiert erheblich weniger SO2 gegenüber
Kohle. Diese Emissionen lassen sich durch den Kauf von schwefelarmem
Heizöl weiter
reduzieren. Die SO2-Emissionen
bei Erdgas sind praktisch zu vernachlässigen.
Stickoxide
(NOx) entstehen bei hohen Temperaturen
und sind im
wesentlichen von der Feuerungstechnik und weniger vom eingesetzten
Brennstoff
abhängig. NOx ist wesentlich für
das Waldsterben und andere
Umweltauswirkungen sowie für Gesundheitsschäden bei
Mensch und Tier, z.B. durch
die Bildung von Ozon in Zusammenhang mit Sonneneinstrahlung,
verantwortlich.
Kohlenmonoxid
(CO) entsteht
bei
unvollständiger Verbrennung, vorwiegend
bei schlecht arbeitenden Feuerungsanlagen (z.B. infolge mangelnder oder
unzureichender Wartung) oder bei unzureichend belüfteten
Heizräumen.
Durch Verbesserung der
Feuerungstechnik an Heizkesseln
konnte in den letzten Jahren der Ausstoß von Kohlendioxid und
Stickoxid
erheblich reduziert werden. Achten Sie bitte deshalb bei Kauf eines
neuen
Kessels und Brenners darauf, dass diese mit dem Blauen Umweltengel
ausgezeichnet sind. Solche Fabrikate zeichnen sich durch besonders
niedrige
Umweltbelastungen aus.
Außerdem sollten Kessel
und Pumpen nicht
überdimensioniert sein, da dies häufig zu einem
Takten der Anlage führen kann.
Dies bewirkt, neben einem höheren Verschleiß, dass
während der Startphasen die
Verbrennung unvollständig und alles andere als schadstoffarm
verlaufen.
Staub entsteht bei der Verbrennung dadurch, dass feste unverbrannte Bestandteile des Brennstoffes oder der Verbrennungsluft, die nicht in die Asche mit eingebunden werden, den Schornstein als Staub verlassen. Je nach Größe der Partikel wird zwischen Grob- und Feinstaub unterschieden. Staubemissionen treten hauptsächlich bei der Kohlefeuerung und im geringen Maß bei der Ölfeuerung auf. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen keine nennenswerten Staubemissionen.
Staub entsteht bei der Verbrennung dadurch, dass feste unverbrannte Bestandteile des Brennstoffes oder der Verbrennungsluft, die nicht in die Asche mit eingebunden werden, den Schornstein als Staub verlassen. Je nach Größe der Partikel wird zwischen Grob- und Feinstaub unterschieden. Staubemissionen treten hauptsächlich bei der Kohlefeuerung und im geringen Maß bei der Ölfeuerung auf. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen keine nennenswerten Staubemissionen.